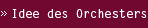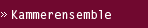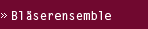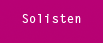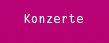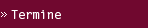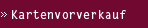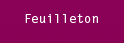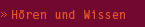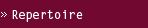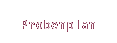Hören und Wissen
Erzähler und Erlöser
Zu Anton Bruckner und seiner Zeit
Gerhard Luber
Einleitung
Anton Bruckners „Romantische Sinfonie“ ist ohne Zweifel ein Koloss – horizontal gesehen (Spieldauer über eine Stunde), vertikal (zur Aufzeichnung braucht man 25 Notenlinien), in der Tiefe des Klanges (die Dynamik geht von pp bis fff), natürlich auch in der Gedankentiefe. Wenn wir ehrlich sind, geht es uns allen, den ausübenden wie den zuhörenden Musikern, mit solchen Kolossen wie schon dem berühmten Wiener Kritiker Eduard Hanslick, der über Bruckners Riesenwerk einmal schrieb: „Wir möchten dem als Menschen und Künstler von uns aufrichtig geehrten Komponisten, der es mit der Kunst ehrlich meint, so seltsam er mit ihr umgeht, nicht gerne wehtun, darum setzen wir an die Stelle einer Kritik lieber das bescheidene Geständnis, dass wir seine gigantische Sinfonie nicht verstanden haben.“
Das Verstehenwollen, noch viel mehr aber der Faszinations-Sog, den wir Conbrioten seit geraumer Zeit beim Proben der „Romantischen“ verspüren – das sind die Gründe, warum wir Sie an drei Abenden ins Wirsberg-Gymnasium einladen, um gemeinsam mit Ihnen die Sache der „Romantischen“ von verschiedenen Seiten her zu betreiben. Hören und Wissen ist das Motto.
Dazu wird nächste Woche Erwin Horn einen Einblick in die Sinfonie und ihre Entstehungsgeschichte geben, und in vierzehn Tagen wird Gert Feser über die Probleme beim Interpretieren eines solchen sinfonischen Kolosses sprechen.
Heute aber soll es um Anton Bruckner selbst gehen. Nicht um einen bloßen Lebensabriss des Komponisten, dazu steht ja zur Not Wikipedia zur Verfügung. Vielmehr aber um die Frage: Wie ist Bruckner mit seiner Zeit verbunden? Ist er in ihr ein Fremdling – oder drückt er seine Zeit, die zweite Hälfte des spannenden 19. Jahrhunderts, vielleicht sogar idealtypisch aus? Was umgibt Bruckner – und wie steht er dazu?
Ich will mich der Frage in vier Versuchen nähern. Jeder Versuch wirft ein eigenes Thema auf, und jeder Versuch bezieht sich auf je einen Satz aus der „Romantischen“. Damit ist die Musik, um die es uns ja zuallererst geht, auch am heutigen Abend schon im Spiel. Und mit Musik wollen wir auch beginnen. Hören Sie den berühmten Anfang des 1. Satzes: IV/1 Takte 1 bis 18
Erster Versuch: Bruckner der Glaubende
Bruckner ein gläubiger Mensch? Das ist keine Frage. Zu offensichtlich tritt die enge Beziehung Anton Bruckners zu seinem Gott und zu seiner Religion in Leben und Werk des Mannes hervor. Bruckner war ein geradezu fanatisch zu nennender Beter – davon zeugen so skurrile Dinge wie die Gebetslisten, in denen er minutiös die von ihm gesprochenen Ave Maria und Vaterunser aufgezeichnet hat, oder seine angestrengten Fastenübungen. Sein Schüler und Freund Franz Schalk vergleicht ihn mit Fra Angelico, dem einzigen Maler, der je heiliggesprochen wurde, und Max Kalbeck, der Brahms-Biograf und Wagner- sowie Bruckner-Feind, verspottete ihn als „Wotan im Bischofsornat“, dem „Freia in der Gestalt einer Pfarrersköchin ... Geselchtes mit Knödeln auftrug“, dem „die Walküren Te Deum laudamus, die Rheintöchter Pax vobiscum sangen und die Choralisten von Zeit zu Zeit Tusch bliesen.“
Bruckners Religiosität steht also außer Zweifel. Die Frage ist vielmehr: Was umgibt den bischöflichen Wotan? Passt er mit seiner Gläubigkeit in seine Zeit? Und da bröckelt die Einvernehmlichkeit auf den ersten Blick. Dominieren den Diskurs um den Glauben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht Leute wie David Friedrich Strauß (der auf seiner Suche nach dem historischen Jesus manche liebgewonnene Sicherheit störte) oder Ludwig Feuerbach (der Gott überhaupt für eine Projektion des menschlichen Geistes hielt), nicht zu vergessen Karl Marx (der die Religion als Opium des einfachen Volkes bezeichnete)? Und befand sich nicht die Kirche generell in einem Abwehrkampf, gegen den aufkommenden Liberalismus und gegen alle mögliche politische Unbill? In Rom hatte der Papst in den Wirren der 1870er Ereignisse, just zur Entstehungszeit der IV. Sinfonie, den Kirchenstaat aufgeben müssen – er fühlte sich fortan als „Gefangener im Vatikan“ und verbot den Katholiken 1874 sogar die Teilnahme an den italienischen Wahlen. In Linz, wo Bruckner an der Orgel saß, kämpfte Bischof Franz Josef Rudigier ebenso zäh wie erfolglos gegen die vom Staat erzwungenen Beschränkungen der kirchlichen Macht, gegen Zivilehe, staatliche Schulaufsicht und die Anerkennung nichtkatholischer Glaubensgemeinschaften. In Deutschland standen die Bischöfe im sogenannten „Kulturkampf“ gegen Bismarck – überall war die Kirche in die Defensive gedrängt. Solche Defensive wirkt sich aber psychologisch aus: Es entsteht eine Wagenburg-Mentalität, man schließt sich zusammen in aggressiver Diskursverweigerung (so etwa lehnte Papst Pius IX. es rigoros in einem Hirtenschreiben ab, sich „mit dem Fortschritt, dem Liberalismus und der heutigen Zivilisation (zu) versöhnen und (zu) vereinigen“). Man schart sich um die Personen und Gedanken, die man als Mitte versteht, um den Papst und die Bischöfe, um die Marienfrömmigkeit, die Sakramentenlehre. Und man tut das auf unversöhnliche Weise – Bischof Rudigier etwa verweigerte sich der staatlichen Rechtsprechung und wurde zu Festungshaft verurteilt. Ein Bischof im Kerker!
Und Anton Bruckner? Der stand mitten drin in der Auseinandersetzung. Kurz nachdem sein Bischof aus dem Gefängnis freigekommen war, wünschte er ihm in einem Brief „Kraft und Ausdauer in schweren Kämpfen“, zum 25jährigen Bischofsjubiläum schrieb er seinem Oberhirten kaum verklausuliert: „Vor dem Hohenpriester wollen die Feinde zurückweichen!“ Und in einem Schreiben an den Linzer Domdechanten Johann Baptist Schiedermayr heißt es ebenso programmatisch wie pathetisch: „Man gebe Cäsarn, was sein ist, solange er nicht verlangt, was Gottes ist!“ Untersucht man nun die geistlichen Werke Bruckners sozusagen auf ihre Kulturkampftauglichkeit, so fällt auf, dass das marianische Thema stark betont ist (Tota pulchra es; Salve regina; Magnifikat u.v.m.), dass es zahlreiche Chorsätze mit Texten gibt, die das Altarsakrament würdigen (allein 9 mal hat Bruckner das Tantum ergo vertont!) und dass die Nennung der „einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche“ in den Credo-Sätzen seiner großen Messen immer im machtvollen Unisonogesang geschieht.
Steht Bruckner aber auch in seiner Sinfonik im Kampf der Kirche mit der Welt? Ich denke ja, und ich will es an zwei Aspekten zeigen. Zum einen gibt es in Bruckners Sinfonien zahlreiche Vortragsbezeichnungen wie „misterioso“ oder „feierlich“, und damit zielt der Komponist nicht nur auf eine bestimmte musikalische Tempovorstellung, sondern er setzt auch einen Gegenpol zum spätaufklärerisch-liberalen Geist seiner Zeit, aus dem heraus seiner geliebten Kirche so viel Unannehmlichkeiten bereitet werden. Und zum anderen tauchen in seinen Sinfonien immer wieder Choräle auf, Bauteile also, die im weltlich-intellektuellen Kontext einer Sinfonie an sich schon verwundern, die in der Brucknerschen Spielart aber ganz besonders deutlich auf Distanz zur Welt, auf Abgrenzung und Behauptung zielen. Hören wir ein Beispiel aus dem 1. Satz der IV.: IV/1 Takte 305 bis 325
Das ist schon ein stattlicher katholischer Auftritt: Schweres Blech wie eine Ritterrüstung, getragene Homophonie, alles in allem „Kraft und Ausdauer in schweren Kämpfen“! Noch deutlicher wird das, wenn man hört, wie Bruckner diesen Choral vorbereitet und ausklingen lässt: IV/1 Takte 289 bis 332
Das klingt in der Tat nach dem würdevoll vorbereiteten Machtauftritt eines „Hohenpriesters“, und fast meint man im Trompeten-Nachsatz die päpstliche Schweizergarde ihre Hellebarden recken zu hören: Den Feinden bleibt nur noch das Zurückweichen!
Unser Resümee kann also nur lauten: Bruckner ist ein Glaubender, und er ist mit seinem Glauben eingebunden in den Geist seines Jahrhunderts. Freilich ist er nicht der frömmelnd-biedermeierliche „Musikant Gottes“, als den ihn süßliche Bruckner-Hagiografie zum Teil noch heute sieht, sondern er ist involviert, kirchen-zeitgeist-modern, er ist der „Musikant des Kulturkampfes“.
Zweiter Versuch: Bruckner der Erzähler
Wenn wir Anton Bruckners innere Verbindung zu seinem Jahrhundert erfassen wollen, müssen wir bei diesem zweiten Versuch zunächst fragen: Ist Erzählen ein besonderes Kennzeichen des 19. Jahrhunderts? Gab es Erzählung nicht vielmehr schon immer!? Ja und nein: Natürlich gab es zu fast allen Zeiten einen erzählerischen Zugriff auf die Wirklichkeit, also die Anstrengung, Weltbeschreibung und Welterklärung auf vorwiegend fiktive, dabei auch dokumentarische Art in locker gebundener Form zu leisten. Aber doch gab es diese Anstrengung nach etwa 1850 in besonderer, intensiverer Weise: Die Literaturwissenschaftler sagen, in dieser Zeit werde das Erzählen gegenüber der Lyrik und dem Drama immer wichtiger, dränge diese anderen Sageweisen der künstlerischen Weltdeutung in den Hintergrund. Das hat soziologische Gründe (das Lesepublikum verändert sich, wird „demokratischer“), das hat auch sozusagen hermeneutische Gründe (die Wirklichkeit ist komplexer geworden, zu ihrer Erfassung braucht es also Systeme, die weniger auf Gefühl und Spannung als vielmehr auf Vernunft und Bildkraft setzen). Greifbar wird diese Macht des Erzählens auch in Wirtschaftszahlen (allein von Gustav Freytags Roman „Soll und Haben“ wurden im ersten Erscheinungsjahr 30.000 Exemplare abgesetzt!). Erzählwerke aus dieser Zeit haben sich übrigens bis heute im kollektiven Gedächtnis mit erstaunlicher Kraft festgesetzt: Kleider machen Leute, Der Schimmelreiter, Effi Briest, Der Nachsommer – und viele andere könnte man nennen.
Nun ist literaturgeschichtlicher Stoff freilich nicht so einfach auf Anton Bruckner zu münzen: Selbst vielen wohlmeinenden Biografen galt er ja als quasi illiterat (obwohl er über eine erstaunliche Bibelfestigkeit verfügte und dazu immerhin Bücher von David Friedrich Strauß besaß!). Zu den Stoffen der Erzähler seiner Zeit hatte er wenig Verbindung, er interessierte sich nicht für die Liebe (nur eine Haushälterin-Ehefrau suchte er zeitlebens!), nicht für die Spannungen zwischen Individuum und Gesellschaft, nicht für die Frage nach Krieg und Frieden. Zudem war er völlig ungesellschaftlich im damaligen Salon-Sinne.
Gesellschaftlich war er aber sehr wohl im Stammtisch-Sinne: Legendär sind seine abendlichen Plauderrunden im Wiener Lokal „Roter Igel“, und die Verheißung breiter Gesprächsseligkeit strömt auch aus einem Brief, den der Steyrer Stadtpfarrer Johann Evangelist Aichinger an den „Hochverehrten Herrn Doctor“ richtete und in dem von dem „bekannten Tische im Speisezimmer des Stadtpfarrhofes, wo wir schon so oft gemüthlich beisammen saßen“, die Rede ist. Bruckner war überdies ein Fabulierer, das geht nicht nur aus der bekannten Anekdote hervor, derzufolge der Kaiser ihm, dem allzu Erzählfreudigen, bei einer Audienz das Wort abschneiden musste, sondern das wird geradezu archetypisch sichtbar schon an einem Zeugnis aus Bruckners Schulzeit. In der St. Florianer Volksschule wurde dem Jungen einmal die Aufgabe gestellt, den einfachen Satz „Der Knabe hat gefangen“ zu erweitern. Hören Sie, was Bruckner daraus machte: „Der kleine Knabe eines armen Taglöhners des hiesigen Ortes hat heute in der Früh beyläufig um 5 Uhr außerhalb des Marktes in einem kleinen Walde, der sogenannten ‚Heimleite’ vermittelst eines kleinen Schlages mit Beyhülfe einer kleinen Lockpfeife eine recht schöne Kohlmeise gefangen.“ Für mich wird an diesem an sich völlig unbedeutenden kleinen Textchen dennoch Großes deutlich: Wie sehr schon der Achtjährige fabulierend erzählen mochte, wie er kleinste Zellen romanhaft verbreitern, detailreich ausmalen, ja mit einem spürbaren Architekturgefühl entwickeln konnte! Was ist ihm nicht alles wichtig: Personal, Zeit, genauester Ort, Handlungsmittel, und schließlich die wahrhaft epische Beifügung, dass die Kohlmeise „recht schön“ gewesen sei!
Jahrzehnte später hat Bruckner in seiner sinfonischen Arbeit die lustvolle erzählerische Geste der Kinderzeit nicht verloren. Erzählerische Geste – in und außerhalb der Literatur – das bedeutet ja: weite Bögen spannen; immer wieder Innehalten; von der eigentlichen Linie abschweifen; Motive verflechten; das eigentlich Erzählte auf einen intimen häuslichen Boden setzen. Gibt es das aber auch in der Musik? Ich will es Ihnen an einer Stelle aus dem 2. Satz der Romantischen Sinfonie zeigen: IV/2 Takte 1 bis 12
Wie Sie sehen, gibt es auch in der Welt der Klänge etwas wie eine erzählerische Geste: den häuslichen Grund in der vorbereitenden Streicherfigur; die räumlich empfundene Weite in der Cellokantilene; das Innehalten und das neue Ansetzen; das Hereinsprechen von Außen im Hornruf. Übrigens ist Bruckners ganz eigene Erzählart nach Meinung mancher Musikwissenschaftler eher parataktisch: die Gedanken reihen sich nach und nach aneinander, die Kernelemente verändern sich wenig – ganz anders als etwa bei Johannes Brahms, dessen Musik von der Zertrümmerung der Motive lebt und sich in „entwickelnder Variation“ fortschreibt. Zum Charakteristischen dieses Erzählflusses gehört auch, dass im weiteren Verlauf der „sinfonischen Geschichte“ Einschübe möglich werden, auch Auslassungen, Umstellungen. Und ein besonderes Merkmal Brucknerschen Erzählens ist die umspielende Anreicherung des Erzählguts durch neue Wendungen, durch fantastisch weitende Seitengedanken – Kommentare eigentlich, die das ursprünglich Gesagte verästeln, verdichten, vertiefen wollen, wie wenn sie um die komplex gewordene Wirklichkeit wüssten, und dabei doch das einmal Gefundene sicher festhalten möchten. Hören wir das eben gespielte Thema etwas später im Satz: IV/2 Takte 101 bis 108
Tritt da nicht zu der ursprünglichen, einfachen Themenaussage hinzu, was der Knabe in seiner Umwelt noch alles eingefangen hat: Personales in der verschobenen Doppelung des Themas, Zeit- und Ortsbestimmungen in der neuen Bassfigur, und in der Geigenfigur das Insistieren darauf, dass alles doch „recht schön“ sei?
In der zeitgenössischen Rezeption der Werke Bruckners wird der Erzählcharakter seiner Musik übrigens bemerkt, aber meist negativ kommentiert: Bruckners große Kritikerplage, der Wiener Musikwissenschaftler Eduard Hanslick, schimpft über die „unersättliche Rhetorik“ der II. Sinfonie. Die Parataxe der Brucknerschen Gedankenentwicklung wird in zahlreichen Konzertkritiken als Formlosigkeit denunziert. Und Max Kalbeck, der schon erwähnte Brahms-Intimus, fordert für die VIII. Sinfonie gar einen „Redacteur ... mit dem Rothstift des Censors bewaffnet“, um den ausschweifenden Erzählungen des Komponisten Einhalt zu gebieten.
Dritter Versuch: Bruckner der Realist
Eng verbunden mit dem Erzählen ist die nächste Fixierung Bruckners in seinem Jahrhundert. Fragt man nämlich nach der literaturgeschichtlichen Epochenschublade, in die das Erzählen im späteren 19. Jahrhundert einzuordnen sei, so kommt man zu dem Begriff des „Realismus“ und dabei zu Namen wie Storm, Keller, Fontane. Realismus beherrschte die Gemüter aber beileibe nicht nur in der Dichtkunst, vielmehr war das Realistische eine absolut allgemeine Tendenz der Zeit – Grund genug zu fragen, ob nicht auch Anton Bruckner Anteil daran hatte. Realismus gab es beispielsweise in der Malerei – erst kürzlich trug eine Münchner Ausstellung über den Bruckner-Zeitgenossen Adolph Menzel den Titel „radikal real“. Und realistisch war man auch in der Politik disponiert – seit Ludwig August von Rochau 1853 den Begriff „Realpolitik“ geprägt hatte, setzte sich mehr und mehr eine Haltung durch, die nicht mehr blind nach dem Idealen und selbstzerstörerisch nach dem Unerreichbaren griff, sondern mit klaren Analysen nach dem aus den Gegebenheiten heraus Machbaren, nach dem vorderhand Möglichen strebte – Bismarck ist der Realpolitiker par excellence. Die Unternehmer der Zeit bringen solche Tugenden ebenso zur Geltung, auch damals schon mit allen Abschweifungen ins moralisch Fragwürdige hinein.
Selbstverständlich zeigte auch Bruckner in seinem Leben realistische Züge. Schon der ständige wirtschaftliche Existenzkampf, den er bis in die 80er Jahre hinein führen musste, nötigte ihm Realismus bis hin zum Opportunismus ab: Bekannt ist seine überaus devote Art, mit der er Bewerbungen um Stellungen oder Stipendien vortrug. Fern von jedem Idealismus begegnet uns Bruckner auch, wenn er seine Unterrichtsstunden manchmal mitten im gerade besprochenen Takt abbrach. Und eine besonders „realistische“, auf bauernschlauer Analyse beruhende Handlungsweise legte er in einem Schreiben an den Tag, das er an den bayerischen König Ludwig II. richtete, mit dem Ziel, eine Privataufführung seiner VII. Sinfonie vor dem König zu erreichen: Er stellte Ludwig doch tatsächlich in Aussicht, im Zustimmungsfall eine Oper zu schreiben! Übrigens zeigte Bruckner auch durchaus politischen Realitätssinn: Als die Sache der Revolution in Österreich 1848 sich zu wenden schien, trat er in die Nationalgarde ein. Und wer das als Jugendtorheit abtun möchte, der sei an die zahlreichen durchaus zeitbewussten Kompositionen vaterländischen Inhalts erinnert, die Bruckner bis hin zur Chorkantate „Helgoland“ von 1893 schrieb – an seine Militärmärsche etwa, an sein „Deutsches Lied“ oder an seinen Männerchor „Lasst Jubeltöne laut erklingen“ zu Feier des Einzugs der kaiserlichen Braut Sissi in Linz.
Es gibt banalen Realismus also im alltäglichen Leben Anton Bruckners – gibt es aber auch zeitgeistig-intellektuellen Realismus in seiner Musik? Carl Dahlhaus, der als einer von wenigen mit systematischen Gedanken zu der naheliegenden Frage hervorgetreten ist, ob der „Realismus“ neben Kunst und Literatur nicht auch die Musik betreffen könnte – Dahlhaus also macht musikalischen Realismus ausfindig etwa in Lautmalerei und Sprachtonfällen, in Affektschilderungen, auch in kleinen wirklichkeitsgetreuen Details, und generell in der „antisubjektiven Gesinnung oder Attitüde“, die Musik eben auch haben kann. Eine solche objektivierende Haltung findet sich vor allem dann, wenn Musik mit außermusikalischer Bedeutung einhergeht, ihren absoluten Anspruch also aufgibt. Im späteren 19. Jahrhundert ist das der Fall bei den sogenannten Programmmusikern, bei Franz Liszt oder Richard Strauss. Eine Neigung zu erklärender Programmanreicherung ihrer Musik gibt es aber auch bei eigentlich „absoluten“ Sinfonikern wie Bruckner und Mahler. Bei Anton Bruckner ist der programmatisch-realistische Zug am stärksten ausgeprägt in der VIII. Sinfonie, deren 4. Satz im Kontext genau fixierbarer politischer Ereignisse steht (es geht um ein Treffen des Zaren mit dem Österreichischen Kaiser in Olmütz). Aber auch in der „Romantischen“ gibt es Realbezüge: In einem Brief an Paul Heyse schreibt Bruckner: „In der 4. Sinfonie ist in dem ersten Satz das Horn gemeint, das vom Rathause herab den Tag ausruft! Dann entwickelt sich das Leben.“ Am deutlichsten „realistisch“ geht es aber im 3. Satz zu. Dort dreht sich alles um die Jagd. Jeder Hörer wird diese Realitätsassoziation sofort haben, wenn er das Folgende hört: IV/3 Takte 1 bis 34
Interessant wird es freilich dann, wenn der formale Anspruch, dem Scherzo ein Trio einfügen zu müssen, auf den programmmusikalischen Realitätsanspruch stößt. Welche Realität wird jetzt vom Komponisten zitiert werden? Im Verlauf der Jahre ändert sich Bruckners Vorstellung vom Realitätsgehalt des Trios der IV. behutsam: In einem Brief aus dem Jahre 1878 sieht er das Trio als „Tanzweise, welche den Jägern während der Mahlzeit gespielt wird“, 1884 ist es eine „Tafelmusik der Jäger im Walde“, und in dem erwähnten Brief an Paul Heyse von 1890 spielt den Jägern „während des Mittagsmahles im Wald ein Leierkasten“ auf. Die musikalische Realität ist dabei immer dieselbe: IV/3 Trio Takte 1 bis 10
Man kann dieses Ständchen im Wald übrigens ganz gewinnbringend mit einem Ständchen von Gustav Mahler vergleichen, das dieser – ebenso im Wald und ebenso im Kontext der Jägerei angesiedelt – in den 3. Satz seiner I. Sinfonie eingebaut hat.
Mahler I/3 Takte xy bis yx
Gewinnbringend ist dieser Vergleich deshalb, weil er auf engstem Raum zwei recht unterschiedliche Arten der realistischen Musikerzählung zeigt: Mahler erzählt die kleine Waldrealie ganz distanziert, wie ein allwissender auktorialer Erzähler, der manchmal mit Wohlwollen, manchmal aber auch mit Häme und Spott auf seine Figuren herunterschaut. Wie hier das Schlagwerk dumpfbackig ins Geschehen drängt! Und in der Partitur ist auch noch angeordnet: „Becken und Trommel von einem Spieler zu spielen!“ Das ist die pure Unterschichten-Blaskapelle in der fürstlichen Jägerei – und im heiligen Tempel der Sinfonie! So eine gebrochene Klangrealität gibt es bei Bruckner nicht. Bei ihm ist die Musik stets unmittelbar und einheitlich, der Klangstrom ist immer personale Rede, nie verbrüdert sich der Komponist über seine Musik hinweg mit den Hörern. Schlichte pathetische Naivität!
Vierter Versuch: Bruckner der Erlöser
Bitte gestatten Sie, dass ich Sie zur Betrachtung des letzten Feldes, auf dem Anton Bruckner und sein Jahrhundert auf Verbindungen untersucht werden sollen, zunächst ganz weit aus der ästhetischen Sphäre hinausführe: auf das Schlachtfeld nämlich. In der militärtaktischen Wissenschaft, bei der Behandlung der Frage also, wie man auf dem Schlachtfeld siegen könne, gab es in der Brucknerzeit zwei beherrschende Ideen – die der Umfassungsschlacht (so wie einst Hannibals Cannae) und die des Durchbruchs. Die Cannae-Idee war ohne Zweifel die militärisch wirkungsvollere (denken Sie an Sedan 1870 oder noch Tannenberg 1914), die Durchbruchs-Idee hingegen war – bei allen Schlachtensiegen, die mit ihr errungen wurden – die sozusagen kulturell erfolgreichere. Das war sie deshalb, weil sie quasi nur die militärische Ausprägung eines großen, zeitbeherrschenden Gedankens gewesen ist, der vielfach hervortrat: „Durchbrüche“ gab (und gibt) es in politischen Verhandlungen, in der Forschung, in der persönlichen Entwicklung. Durchbruch ist immer dann, wenn etwas aus der Enge ins Weite geht, aus der Finsternis ins Licht, aus Fesseln in die Freiheit, aus Verwirrung in die Klarheit. Und die kulturelle Attraktivität der Durchbruchs-Vorstellung ergibt sich auch daraus, dass sie ihrerseits einem größeren Kontext angehört – dem der Erlösung nämlich. Seit Paulus uns im 1. Korintherbrief verheißen hat, dass wir aus der Rätselhaftigkeit dieser Welt durchbrechen werden zur lichtvollen Schau „von Angesicht zu Angesicht“, wird Erlösung durchbruchshaft gesehen. Und gerade im späteren 19. Jahrhundert, in dem es gewaltige Elementarkonflikte wie diejenigen zwischen den Nationen, zwischen Staat und Kirche, zwischen Industrie und vorindustrieller Welt gab, und in dem Gewalt als Mittel der Konfliktlösung noch nicht einmal auf dem Papier geächtet war – gerade in einer solchen Zeit war „Durchbruch“, zumal als Spielart von „Erlösung“, ein attraktives Modell zum Weltverstehen und Weltgestalten.
Und ein Modell, das sich mit musikalischen Mitteln darstellen lässt. Letztlich ist „Durchbruch“ ein Ereignis in zwei Stufen: Es gibt eine Anbahnungsstufe, in der die Konfliktelemente sich ballen und steigern, und es gibt eine Explosionsstufe, in der sich die Spannung löst, indem die Energie sich zielgerichtet entlädt. In der Musik kann das über wenige Takte hin geschehen, oder das Durchbruchgeschehen spannt sich in der Ballung von thematischem Material über ein ganzes Werk, bis hin zur Schlussapotheose. Für Anton Bruckner ist die Anlage von Durchbruchsituationen ganz charakteristisch: es gibt sie auf thematischer Basis (meistens in den Ecksätzen), auf harmonischer Basis (in den langsamen Sätzen), und es gibt auch verweigerte Durchbrüche (u.a. in den Scherzi – wir haben vorhin einen solchen verweigerten Durchbruch gehört!). Die Zeitgenossen nahmen die verschiedenen Ausprägungen des Durchbruchs-Zeitgeistphänomens in Bruckners Musik vielfach wahr. Hugo Wolf spürte Ungenügen: „Überall ein Wollen, kolossale Anläufe, aber keine Befriedigung, keine künstlerische Lösung.“ Bewunderung empfand hingegen ausgerechnet ein Soldat, der Oberstleutnant von Himmel, Adjutant des österreichischen FZM Grafen Huyn, der über eine Orgelvorführung Bruckners das Folgende zu Papier brachte: „Mit hocherhobenem Haupte und begeistertem Blicke thront der Künstler inmitten des tosenden und brandenden Meeres von Tönen und mit gewaltiger Kraft und souveränem Willen beherrscht er die hochschäumende, himmelstürmende Flut. Endlich durchbricht das grollende Wogen ein wundersüßer Klang, wie wenn ein heiterer Sonnenblick durch finstere Wolken dringt. Und nun reiht sich perlend Ton an Ton zur mächtig schwellenden Harmonie des anfänglichen Themas; es glätten sich dunkle Wogen, und endlich jubelt laut und hell der Triumphgesang, mit dem die ganze Schöpfung ihren Herrn lobt und preist!“ So ähnlich klingt es auch am Ende der „Romantischen Sinfonie“. Hören wir den Schluss des 4. Satzes: IV/4 Takte 505 bis Ende
Das ist ein typischer Bruckner-Durchbruch, einer der schönsten vielleicht: aus der Ballungssituation der „dunklen Wogen“, mit lichthafter Ankündigung in den Trompeten, mit einer letzten Steigerungswelle, und schließlich mit dem Triumphgesang des Anfangsthemas der Sinfonie. Und mit zusätzlicher Bedeutung: Die letzte Steigerungswelle vor dem Durchbruch nach Es-Dur wird klanglich getragen von den Posaunen. Diese Instrumentenfarbe und die musikalische Diktion erinnern an eine andere Komposition Bruckners, an sein Te Deum, dessen Entstehungszeit sich mit der letzten Umarbeitungszeit des Finales der IV. berührt: Te Deum 5 Takte 449 bis 456
Da aber – Sie haben es gehört – kommt außermusikalische Bedeutung ins Spiel: „Non confundar in aeternum“ lautet der dem Posaunensatz zugehörige Text. Eine erste, ferne Ahnung von diesem Thema will uns der Komponist vielleicht auch in seiner großen Durchbruchszenerie am Ende der „Romantischen“ geben: die Klangmassen ballen sich aus der trotzig ausgestoßenen Hoffnung heraus zusammen – „In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden werden“ –, und die Musik formt die Hoffnung im erlösenden Durchbruch um zur Gewissheit.
Schluss
Hier – im triumphalen Ende der IV. Sinfonie – zeigt sich Anton Bruckner also nach allen unseren vier Ansätzen als Mensch seiner Zeit: als trotzig Glaubender, als realistischer Erzähler einer außermusikalischen Wahrheit, und als Apostel der Erlösung. Felsenfest scheint er in seinem 19. Jahrhundert verortet, und wenn die Ausgangsfrage lautete, ob in Bruckner typische Strömungen seines Jahrhunderts zutage träten, so kann man sagen: Das tun sie. Quod erat demonstrandum.
Und darüber hinaus? Bruckner für Heutige? Stutzig muss uns ja machen, dass viele Zeitgenossen in Bruckner einen Fremdkörper gesehen haben. Im Jahr 1877 nannte die Wiener Abendpost den Komponisten in einer Besprechung der III. Sinfonie einen „verspäteten Sendling des Antediluviums“. Und selbst sein Schüler und Freund Franz Schalk schrieb in einem Aufsatz über ihn: „Kaum je hat ein Künstler sich in solchem Gegensatz zu seiner Zeit befunden“ – und meinte damit Bruckners Stellung als Sinfoniker unter Programmatikern, als Naiver unter Intellektuellen, als Glaubender unter Liberalen. Sollte dieses damalige Fremdheitsempfinden seinen Grund nicht auch in einer irgendwie gearteten Modernität Bruckners für uns Heutige haben?
Wer heute nach Anton Bruckners Aktualität fragt, hört Verschiedenes: Lorin Maazel etwa findet sie in der „Majestät“ und „Reinheit“ seiner Musik und in der „geistvollen Einfalt“ seines Wesens. Der Bruckner-Exeget Constantin Floros ist fasziniert von der Brucknerschen Charaktermischung aus Autoritätsgläubigkeit und Wagemut (etwa in der Harmonik) und entdeckt darin ein Paradigma der Moderne. Sehr ehrlich und vielleicht am meisten hilfreich ist das, was die 25jährige Geigerin Julia Fischer über den Komponisten sagt: „Mit Bruckner kann man mich heute jagen.“ Und auf die Interviewer-Frage, ob sie sich vorstellen könne, dass sie ihn einmal später lieben werde, sagt sie: „Ja, weil ich weiß, was mich an ihm stört: dass er einen Zustand und nicht eine Entwicklung beschreibt. Er kreiert eine Welt, die in sich abgeschlossen ist. Das passt nicht zu mir, wie ich heute bin. Wenn ich irgendwann einmal mein Leben als eine Konstante sehen werde, dann werde ich seine Musik anders empfinden.“
Und so bleibt, meine Damen und Herren – ein Trost für uns – Anton Bruckner als Aufgabe für den reifen Menschen.